5.08.2025
8 mei
1.27.2020
8.11.2015
eenheidsdenken rond Sjostakovich
Op 9 augustus 1975, 40 jaar geleden dus, stierf de Sovjet componist Dmitri Sjostakovich. Je kunt geen publicatie over deze componist ter hand nemen, over er staat een passage in over de 'moeilijke verhouding met het Kremlin'. Er worden zelf hele 'analyses' gemaakt over zijn werk waarbij elke passage, elke noot,
wordt gekoppeld aan een vermeende gemoedstoestand, als gevolg van een vermeende richtlijn of een conflict met de blijkbaar alles controlerende en omni -aanwezige Stalin. Als een componist, of een cineast zoals Eisenstein, of een auteur of beeldende kunstenaar, niet kan verguisd worden of erger nog simpelweg genegeerd, dan kan het toch niet zijn die persoon progressief zou kunnen geweest zijn. Een baanbrekend componist kan toch, vanzijnleven, nooit communist zijn? Het Duitse blad junge Welt ging deze week dieper in op deze merkwaardige manier van denken. We nemen dit hier met graagte integraal over: |
Am 9. August 1975 starb Dmitri Schostakowitsch im Alter von 68 Jahren. Sein 40. Todestag ist der jungen Welt Anlass, in einer Reihe von Beiträgen an den sowjetischen Komponisten zu erinnern. Dazu erschienen auf diesen Seiten bisher eine Besprechung von Ole Anders Tandbergs Inszenierung der Oper »Lady Macbeth von Mzensk« in der Deutschen Oper zu Berlin (31.1.), ein Vorabdruck aus Patrick Bades Buch »Music Wars 1937–1945« (8.6.), und zwei Tage später wurde der Filmkomponist Schostakowitsch vorgestellt. Am 28. Juni stand hier eine Kritik der 6. Internationalen Schostakowitsch-Tage in Gohrisch.
Heute gibt es kaum Literatur über den Tonsetzer, die ihn nicht als Gegner des Sowjetstaates und speziell Stalins ausmacht. Maßgebend dafür ist das Buch des Dissidenten Solomon Wolkow »Testimony«, Zeugenaussage, das 1979 in den USA erschien. Dessen Einschätzung hat das bürgerliche Feuilleton übernommen – und sie drang im Laufe der Jahre auch in das Bewusstsein von Linken ein. Welches Kartenhaus hier aufgebaut wird, soll heute auf den Themaseiten gezeigt werden. Schostakowitsch ist unser Komponist. (jW)
Am 9. August 1975 starb im Alter von fast 69 Jahren der große sozialistische Komponist Dmitri Schostakowitsch. Vier Jahre später erschien in New York ein Buch, das sich als die »Memoiren« von Schostakowitsch ausgab. Sein Verfasser, der sowjetische Dissident Solomon Wolkow, suggerierte mit dieser Veröffentlichung, dass der Komponist keinesfalls ein Anhänger der Sowjetmacht, der kommunistischen Idee und der gesellschaftlichen Emanzipation, sondern vielmehr ein heimlicher bürgerlicher Individualist gewesen sei, der alles abgelehnt hätte, was irgendwie mit kollektiver Solidarität, staatlicher Organisation und parteilicher Leistung zu tun gehabt hätte. Der Rückzug ins Private im Spätwerk und die Zurückhaltung Schostakowitschs bei öffentlichen Auftritten belegten laut Wolkow, dass der politische Druck in der Sowjetunion so groß war, dass der Komponist es nicht wagte, seine eigentlichen Ansichten noch zu Lebzeiten zu offenbaren. In den wenigen Begegnungen Wolkows mit dem Musiker seien aber die Aufzeichnungen für die »Memoiren« entstanden, die er dann geordnet, ausformuliert und Schostakowitsch zum Gegenzeichnen vorgelegt hätte. Daher sei das Material authentisch, wenn auch, wie die erste Immunitätsklausel im Vorwort des Buches schon leicht verräterisch vorbaute, gesagt werden müsse, dass sich Schostakowitsch oft widersprochen hätte und er, Wolkow, den »wirklichen Sinn seiner Worte« erraten musste.¹
Nun, der vorgeschobene Zeuge konnte sich nicht mehr wehren. In Anbetracht der generellen Tendenz der Abhandlung, alles Sowjetische zu denunzieren und bis auf den Mikrokosmos der »russischen« Intelligenz auch nichts anderes als akzeptabel zuzulassen, erstaunte die Zeitgenossen wohl doch, dass Schostakowitsch nicht eine seiner Reisen ins westliche Ausland genutzt hat, um der Heimat den Rücken zu kehren. Auch dafür hatte Wolkow, in Form der zweiten Immunitätsklausel, eine Ausrede parat, denn er deutete an, dass der Komponist die westliche Öffentlichkeit als abstoßend empfand. Dennoch heißt es gleich anschließend mit Verve: »Fraglos stand Schostakowitsch mit ganzem Herzen auf seiten der Liberalen.« Woher Wolkow das wissen wollte, wurde natürlich nicht gesagt.
Wenn man sich die »Zeugenaussage« aus der Perspektive des Jahres 2015 noch einmal anschaut, dann fällt auf, dass sie eine höchst konstruierte Mischung aus Totalitarismus, imperialistischem Geschichtsbild und Antikommunismus darstellen. Das war für den westlichen Zugang zum sozialistischen Weltsystem schon im Jahre 1979 in den Hauptfällen üblich und erscheint mit dem Wissen um die ideologische Denunziation aller sozialistischen Vorstellungen und Grundwerte in der Gegenwart kaum mehr überraschend. Was hingegen deutlich zutage tritt, ist die Tatsache, dass selbst bei nur rudimentären Kenntnissen über Leben und Werk von Schostakowitsch die Aufzeichnungen von Wolkow als falsch zurückzuweisen sind. Methodik und Stilistik gehen immer dann in die Feder Wolkows über, wenn allgemeine Aussagen zur sowjetischen Politik gemacht werden, die zum Teil so eindimensional und unreflektiert sind, dass sie kaum woanders als am Dissidentenküchentisch entstanden sein können, an dem gerade Schostakowitsch nicht gesessen hat. Etwas besser sieht es mit den musikimmanenten und aufführungstechnischen Äußerungen Schostakowitschs aus, die viele Musikwissenschaftler (z. B. den Biographen Krzysztof Meyer und den Musiktheaterexperten Gerd Rienäcker) späterhin zu der Auffassung verleitet haben, weil das Musikalische in den »Memoiren« durchaus richtig sei, könne das Politische wenigstens nicht völlig aus der Luft gegriffen sein.
Nichts von Schostakowitsch
Die rücksichtslose Ausbeutung der Schwierigkeiten Schostakowitschs mit Instanzen der sowjetischen Administration erfolgte von Wolkow auf der Ebene des Traktats als Aufforderung an die Leserschaft, das Ganze zu glauben. Kernpunkte waren dafür die Auseinandersetzung um Schostakowitschs Oper »Lady Macbeth von Mzensk« im Jahre 1936 und der Beschluss des Zentralkomitees der KPdSU (B) vom 10. Februar 1948 zu den formalistischen Tendenzen in der sowjetischen Musik. In beiden Fällen war der Komponist zwar direkte Zielscheibe einer zum Teil deutlich überzogenen Kritik, wurde jedoch nicht für immer kaltgestellt und auch nicht von seinen Überzeugungen zur Schaffung einer sowjetischen Avantgardemusik abgebracht. Selbst die offizielle »Enzyklopädie der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken«, die 1950 in einer deutschen Ausgabe erschien, erwähnte Elemente der sinfonischen und filmdramatischen Musik von Schostakowitsch positiv (die 5. Sinfonie von 1937, den ersten Satz der 7., der »Leningrader« Sinfonie mit dem »Invasionsthema« sowie die Filmmusik zu Friedrich Ermlers Kirow-Film »Der große Patriot« von 1938/39). Mit der von ihm selbst zurückgehaltenen 4. Sinfonie aus dem Jahre 1936, die schließlich Ende 1961 uraufgeführt wurde, war Schostakowitsch seiner Zeit weit voraus und hätte mit Sicherheit noch größeres Unverständnis in politischen Kreisen hervorgerufen, so dass es von ihm klug war, hier die Zeit abzuwarten. Unter die Folie solch künstlerischer Einengungen, die aus den Zeitkonstellationen und nicht aus politischer Willkür zu erklären sind, legte Wolkow nun aber vermeintliche Einsichten Schostakowitschs, die aus diesen Konstellationen resultieren sollten, obwohl sie dann völlig zusammenhanglos im Raum standen.
Als nicht von Schostakowitsch stammend sind z. B. folgende Thesen Wolkows einzuschätzen: Stalin und Hitler seien »Geistesverwandte« gewesen; die »Leningrader« Sinfonie hätte Stalin zum Thema und nicht den deutschen Überfall. Für die sowjetische Kunst wäre der Tod kein Gegenstand, sondern nur Optimismus (sowohl die Dramen und Werke der Vorkriegszeit von Wsewolod Wischnewski, Walentin Katajew und Nikolai Ostrowski als auch die nach dem Überfall Hitlerdeutschlands von Konstantin Simonow, Alexander Fadejew und Michail Scholochow als auch die Erinnerungen an den Großen Vaterländischen Krieg müssen Wolkow »entfallen« sein). Stalin sei »natürlich« »nur halb bei Verstand« gewesen, und er hätte Mussolini »imitiert« (in der Architektur), der »ihm imponierte«. Die Lyrikerin Anna Achmatowa soll als »Genius« der UdSSR gegolten haben usw. All dies gipfelt bei Wolkow in einem Satz über Modest Mussorgskis Oper »Chowanschtschina« von 1886, der in die damalige (nicht vorhandene, aber von Dissendenten erwünschte) Gegenwart verweisen soll: »Das Thema steht für Russland, das eines Tages frei atmen können wird.« Wolkow hatte also schon bis hierhin ganze Arbeit geleistet, die sich dann auch noch entwickeln ließ, als er zwischendurch auf verhasste Personen zu sprechen kam.
Prokofjew, Majakowski, Eisenstein
Ein typisches Gebaren einer gewissen Variante des Intellektuellen besteht darin, größere oder ebenbürtige Rivalen in den harschesten Tönen abzuqualifizieren. Schostakowitsch wurde so etwas nie nachgesagt, und es war auch überhaupt nicht als seine Art der Disputation bekannt. Dennoch bekamen der Komponist Sergej Prokofjew, der Dichter Wladimir Majakowski und besonders der Filmregisseur Sergej Eisenstein in dem Buch »Zeugenaussage« die abfälligsten Urteile hinterhergeworfen. Alle drei Persönlichkeiten vereinte etwas, das für Wolkow offenkundig unerträglich war. Sie hielten am Kommunismus fest, solange sie lebten. Sie kamen alle drei aus freien Stücken aus dem Westen in die Sowjetunion zurück – Prokofjew 1933 aus Frankreich, Majakowski nach Aufenthalten u. a. in den USA und Frankreich sowie Eisenstein 1932 aus Mexiko. Ihre öffentlichen Äußerungen waren niemals antisowjetisch. Und ihre Werke sind, bei aller möglichen Widersprüchlichkeit im Detail, Beiträge zur angestrebten Vervollkommnung der sozialistischen Bewusstseinsbildung.²
Es könnte so gewesen sein, dass Schostakowitsch mit seinem feinen Gespür für Kompositionstechnik die gröbere Art des Komponierens von Prokofjew nicht mochte. Dann allerdings hätte die noch gröbere Form Igor Strawinskys doch die viel dankbarere Angriffsfläche geboten. Strawinsky aber wurde in Wolkows Buch gelobt, während Prokofjew seitenweise der Niedertracht geziehen wurde. Noch bezeichnender fiel das Verdikt aus, als sich die Abhandlung auf das bürgerliche Ideal egoistischer Selbstbestimmung besann. Zitiert wurde zunächst der russische Lyriker Nikolai Nekrassow (1821–1878) mit den Worten: »Ein Dichter brauchst du nicht zu sein, ein Bürger aber unbedingt …«, um sodann fortzufahren: »Ein Bürger im Sinne Nekrassows war Majakowski nicht. Er war ein Lakai, der seinem Herrn untertänigst diente, indem er sein Scherflein zur Verherrlichung des unsterblichen Führers und Lehrers beitrug. Und er war nicht der einzige, sondern nur einer aus einer glorreichen Kohorte, die ihre Schaffensimpulse der Persönlichkeit des Führers und Lehrers verdankten und sein Wirken bejubelten. Eisenstein wäre hier vorrangig zu nennen mit seinem Film ›Iwan der Schreckliche‹, zu dem Prokofjew die Musik schrieb.« Da waren sie dann alle zusammen, die Verhassten von Wolkow, in den Mund gelegt einem Schostakowitsch, der nunmehr wider alle biographische Verlässlichkeit etwas zu Protokoll zu geben hatte, was nachweislich nicht stimmen konnte.³
Im Zusammenhang mit Eisenstein kam eine noch verächtlichere Pose hinzu, die seine Inszenierung von Richard Wagners »Walküre« (1870) im Moskauer Bolschoi-Theater vom November 1940 betraf. Unter Absehung jeglicher Kontextualisierung und vor allem auch der unzweifelhaften antifaschistischen Grundhaltung Eisensteins bezichtigte das Buch den Regisseur der Gewissenlosigkeit, im Schatten des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrags ausgerechnet die »Liebe zu den Faschisten« mit Hilfe dieser Opernaufführung zu zeigen. Überdies wurde dort behauptet, dass die Premiere dann ein großer Erfolg gewesen wäre, die Zeitungen »überschwengliche Kritiken« gebracht hätten und so ein »neuer Triumph an der Kunstfront« entstanden sei. Auch diese Meinungsäußerung ist unzutreffend.
Eisenstein beabsichtigte natürlich etwas anderes. Schon seit geraumer Zeit davon überzeugt, dass im Mittelpunkt der »Walküre« das Thema »Mitleid« und »Vereinzelung« stehe, wollte er beweisen, dass der Wagner-Kult des faschistischen Deutschlands auf einem Missverständnis des Werks beruhte und man gerade an diesem Stück eine Verbindung herstellen könnte zwischen dem Wunsch nach Einheit der Harmonie zwischen Mensch und Umwelt und der kommunistischen Gesellschaftsstruktur. An diesem Projekt scheiterte er in der ästhetischen Umsetzung, weil sein filmisches Montageverständnis der musikalischen Bühnenarbeit inzwischen etwas im Wege stand. Dafür hatte er jedoch erreicht, dass die Tragödie des Individualismus in der Tat weltliche Gründe aufweist, und man dies anhand der Oper auch erkennen konnte. Deutsche wie sowjetische Rezensenten reagierten eher abweisend auf die symbolträchtige Inszenierung. Und gleich gar nicht konnte darüber hinaus davon gesprochen werden, dass der Nichtangriffsvertrag »ein Ausdruck der Völkerverbrüderung« gewesen wäre, wie der Philosoph Dieter Thomä 2006 in seiner überzeugenden Vergleichsanalyse des Werks von Wagner und Eisenstein schreibt.⁴
Über Quellenredlichkeit
Bei Thomä findet sich auch noch einmal in einer längeren Passage in Auszügen das Zitat aus der »Zeugenaussage« über Eisensteins »Walküre«-Engagement. Unter Verwendung von Forschungsergebnissen der britischen Russlandspezialistin Rosamund Bartlett führt er aus: »Bartlett macht den Vorbehalt, dass Teile dieser Memoiren möglicherweise gar nicht auf Schostakowitsch selbst zurückgehen, sondern auf Solomon Wolkow, der sie aufgezeichnet, aber teilweise vielleicht auch verfasst hat.« Diese Vorsicht in der Beurteilung war zum Zeitpunkt der Niederschrift eigentlich schon unbegründet. Zwei Jahre früher, 2004, wurde nämlich als »A Shostakovich Casebook« eine umfassende Replik auf die Verfälschungen der »Zeugenaussage« veröffentlicht, die auch Texte beinhaltete, die schon kurz nach dem Erscheinen der Wolkow-Memoiren 1979 deren Authentizität massiv in Frage stellten. Insbesondere die Arbeiten der akademisch nicht angebundenen US-amerikanischen Schostakowitsch-Biographin Laurel E. Fay bewiesen die methodischen Schwächen und die bewusste Entstellung von Quellenmaterial. In einem ersten Aufsatz von 1980 hieß es bei ihr, dass die Authentizität der »Zeugenaussage« sehr stark in Zweifel zu ziehen ist.⁵ In einer Überarbeitung von 2002 bestätigte sie ihre Erkenntnisse und radikalisierte die Einschätzung sogar noch, indem sie anmerkte, dass im wenig naheliegenden günstigsten Fall die »Zeugenaussage« höchstens ein simulierter Monolog sei, der wichtige Quellen zu Schostakowitsch ignoriert. Im schlimmsten Fall jedoch sei das Buch »Betrug« (»a fraud«) und großer Verrat an den Prinzipien und Idealen Schostakowitschs, der von Wolkow zum wehrlosen Objekt im Kalten Krieg gemacht wurde.⁶
Es ist interessant, dass die Kontroverse um die »Zeugenaussage« trotz der vorliegenden Eindeutigkeit der Fadenscheinigkeit (ongeloofwaardigheid) des Buches weiter am Leben erhalten wird. Für den Musikwissenschaftler Gerd Rienäcker bestimmten die »Memoiren« sogar weithin sein Schostakowitsch-Bild, wie er 2006/07 resümierte. Er berief sich dabei auf sie scheinbar bestätigende Aussagen des Komponisten selbst, die der Dirigent Kurt Sanderling und der Musikhistoriker Harry Goldschmidt vom Komponisten gehört haben wollten. Auch der marxistische Musiksoziologe Georg Knepler wurde als Bestätigung herangezogen: »Die von Wolkow aufgezeichneten Äußerungen entsprächen Schostakowitschs Denken großenteils (Knepler sprach von 88 Prozent!).«⁷ Wie kam denn Knepler auf diesen absurden Wert? Und welche zwölf Prozent sollten dann die Unwahrheit sein? Ein genauer Blick in den Schlussteil der »Zeugenaussage« bringt des Rätsels Lösung. Rienäcker war einer Ironie von Knepler aufgesessen, ohne sie zu bemerken. Wolkow berichtete, dass Schostakowitsch bei offiziellen Anlässen manchmal wenig sagte. Wenn die Fotografen ihr Erinnerungsfoto schossen, bewegte er einfach die Lippen mit der Aussprache der Zahl »achtundachtzig«. Das ergäbe den Eindruck eines Gesprächs, womit die Fotografen zufrieden gewesen wären. Genau auf diese Nullaussage spielte Knepler an, als er den Erkenntnisgehalt der »Memoiren« umschrieb – sie bedeuteten nicht mehr als das Bild, das sich der Westen von Schostakowitsch machen wollte.Die »Zeugenaussage« ist also insgesamt ein authentisches Dokument für die bewusste Steuerung der politischen Stimmung im Kalten Krieg gegen einen der integersten Künstler des sowjetischen Staates. Mit der Geschichte der Propaganda im Rahmen des Ost-West-Konfliktes hat dieses Buch sehr viel, mit Zeugenschaft sehr wenig zu tun. Offen ist eher noch die Frage, mit welch logistischer Unterstützung aus dem Parteiapparat es möglich war, der politisch absolut einflusslosen Opposition der UdSSR im Westen eine derart prominente Bühne zu verschaffen und dabei gleichzeitig einen der wichtigsten Repräsentanten der progressiven sowjetischen Kulturpolitik zu opfern.
Der ideologische Klassenkampf
Dass der ideologische Klassenkampf weiterhin von oben geführt wird, erstaunt nur diejenigen, die das bürgerliche Ammenmärchen vom guten Willen und der Friedfertigkeit des Spätimperialismus unserer Tage bereitwillig zu ihrem Leitsatz erkoren haben. Die Glaubwürdigkeit dieser Epoche ist jedoch weiterhin unsicher, und Schostakowitsch ist offenkundig immer noch zu sehr als Kommunist im Gedächtnis. Anders könnte schwer erklärt werden, wieso im Jahre 2011 und durchgesehen 2014 nochmals eine umfassende Verteidigungsschrift für die »Zeugenaussage« von Mitstreitern Wolkows unter dem provokant martialischen Titel »The Shostakovich Wars« veröffentlicht wurde. Sie bietet an sich nichts Neues, sondern wiederholt nur mit ausladender Geste nahezu alle Thesen der »Memoiren«. Da in den Chefetagen der bürgerlichen Kommunismusforschung offizielle Quellen per se als unglaubwürdig eingeschätzt und Gegenstimmen in der Regel als »gefärbt« oder »sozialistisch kontaminiert« zurückgewiesen werden, verbleibt auch diese neuere Publikation auf der Ebene subjektiver Meinungstäterschaft, fährt reihenweise »Bestätigungsstatements« auf und illustriert auf schlagende Weise den Erkenntnisverlust in der Gegenwart mit der Verwechslung von Meinung und Wissen. Beispielhaft dafür sind die Äußerungen des finnischen Übersetzers und der deutschen Übersetzerin der »Zeugenaussage«, die beide retrospektiv behaupten, von vornherein anhand der Stilistik, der Diktion und des Bildungshintergrundes die »Memoiren« als unleugbar von Schostakowitsch geschrieben erkannt zu haben. Zu dieser Auffassung kann nur gelangen, wer nicht mit den elementaren Regeln der Quellenkritik vertraut gemacht worden ist. Gerade in der Stilistik sind die Einfügungen von Wolkow deutlich sichtbar, und was den »Bildungshintergrund« betrifft, ist Belesenheit ja durchaus das Mindeste, was man auch Dissidenten zutrauen können müsste. Das bürgerliche Bewusstsein kann sich einfach den gleichen Effekt der von seinem Standpunkt aus verdammungswürdigen arglistigen Täuschung und erwünschter politischer Täuschung nicht vorstellen. Vergliche man die »Zeugenaussage« mit den 1979 entstandenen (und 1988 erstmals veröffentlichten) Erinnerungen »Aus der Sicht meiner Generation« des 1915 geborenen Schriftstellers Konstantin Simonow, dann würde auf schlagende Weise klar, wie Inhalt, Stilistik, Diktion und Bildungshintergrund bei authentischen und tatsächlich selbst geschriebenen Memoiren aussehen müssten. Aber Simonow ist für diese Leute aufgrund seiner »Staatsnähe« selbstredend kein brauchbarer Zeuge.Der somit für den ideologischen Klassenkampf schön hergerichtete Titel des Wolkow-Buchs verfehlt sachliche Richtigkeit. Korrekter hätte er zu lauten: »Meine Gespräche mit Schostakowitsch. Eine politische Interpretation. Von Solomon Wolkow«. Ein solches Buch hat Wolkow 2004 verfasst: »Stalin und Schostakowitsch. Der Diktator und der Künstler«.⁸ Wer nun die »Zeugenaussage« kennt, erfährt natürlich lediglich Variationen der politischen Endlosschleife vom insgeheimen Dissidenten Schostakowitsch, der Tyrannei Stalins, der absoluten Knebelung der »russischen« Intelligenz und anderes mehr. Auch diese Arbeit stimmt interpretativ hinten und vorne nicht, aber auffällig ist zweierlei: Auf die »Zeugenaussage« wird kein Bezug mehr genommen, und die Einwände aus dem »Shostakovich Casebook« werden vollständig übergangen. Die in dem Porträt genutzte Form der ideologischen Rhetorik ist selbstverständlich ehrlicher, wenn sie auch dadurch nicht sachlicher wird. Manipulativ bleibt der ganze Wolkow trotzdem, so wenn er z. B. in der Reflexion Eisensteins über seinen Theaterlehrer Wsewolod Meyerhold (1874–1940) dessen Memoiren verkürzt und damit sinnentstellend zitiert oder wenn er als Konklusion die gewöhnliche artifizielle These anbietet, Schostakowitschs Musik sei »weder pro- noch antisowjetisch, sondern einfach nichtsowjetisch« gewesen. Nichts wirkt so falsch wie dieser letzte Satz bürgerlicher Herkunft, deren Horizont so begrenzt ist wie der wohlige Schauer am Untergang der Existenz des auf sich selbst zentrierten Intellektuellen, der subjektive Empfindungen zu objektiven Kriterien umdeutet.Der 40. Todestag des revolutionären Komponisten Dmitri Schostakowitsch sollte einem neugierigen Publikum Anlass genug sein, das monumentale Werk selbst sprechen zu lassen, das ohne die produktive Perspektive des Sozialismus und die positive Ausrichtung auf die Sowjetunion gar nicht entstanden wäre.Anmerkungen
1 Vgl. Zeugenaussage. Die Memoiren des Dmitrij Schostakowitsch. Aufgezeichnet und herausgegeben von Solomon Volkow (1979), Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1981, S. 142 Das müssen auch neuere biographische Arbeiten zugeben, obwohl sie sich sehr bemühen, den herrschenden Analysekonsens der Abspaltung des revolutionären Geistes von der ästhetischen Produktionseinstellung zu bedienen. Vgl. dazu z. B. Elsbeth Wolffheim: Wladimir Majakowskij und Sergej Eisenstein, Hamburg 2000, und Friedbert Streller: Sergej Prokofjew und seine Zeit, Regensburg 20033 Das hätte man alles zwischen 1975 und 1979 schon wissen können. Zuverlässiges biographisches Einführungsmaterial in Form von Erinnerungen oder Aufzeichnungen, wenn auch noch nicht immer vollständig, existierte über alle drei bereits seit Mitte der 1960er Jahre.4 Dieter Thomä: Totalität und Mitleid. Richard Wagner, Sergej Eisenstein und unsere ethisch-ästhetische Moderne. Frankfurt am Main 2006, S. 28; das folgende Zitat befindet sich auf S. 27.5 Laurel E. Fay: Shostakovich versus Volkov. Whose Testimony? (1980), in: Malcolm Hamrick Brown (Ed.): A Shostakovich Casebook. Bloomington/Indianapolis 2004, S. 196 Vgl. Laurel E. Fay: Volkov’s Testimony Reconsidered (2002), in: A Shostakovich Casebook, siehe Anmerkung 5, S. 57 f.7 Gerd Rienäcker: Unterwegs zu Dmitri Schostakowitsch – in fünfzehn Schritten, S. 58 Solomon Wolkow: Stalin und Schostakowitsch. Der Diktator und der Künstler, Berlin 2004
een prachtig voorbeeld van zijn oeuvre, Symfonie nr. 10 in e, opus 93, opgenomen op 4 november 2011 in Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht, door het Nederlands Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Pablo Heras Casado voor NPO 4.
5.19.2015
Fidel Castro over 8 mei en de toekomst
The 70th anniversary of the Great Patriotic War will be commemorated the day after tomorrow, May 9. Given the time difference, while I write these lines, the soldiers and officials of the Army of the Russian Federation, full of pride, will be parading through Moscow’s Red Square with their characteristic quick, military steps.
Lenin was a brilliant revolutionary strategist who did not hesitate in assuming the ideas of Marx and implementing them in an immense and only partly industrialized country, whose proletariat party became the most radical and courageous on the planet in the wake of the greatest slaughter that capitalism had caused in the world, where for the first time tanks, automatic weapons, aviation and poison gases made an appearance in wars, and even a legendary cannon capable of launching a heavy projectile more than 100 kilometers made its presence felt in the bloody conflict.
From that carnage emerged the League of Nations, an institution that should have preserved peace but which did not even manage to stop the rapid advance of colonialism in Africa, a great part of Asia, Oceana, the Caribbean, Canada and a contemptuous neo-colonialism in Latin America. Barely 20 years later, another atrocious world war broke out in Europe, the preamble to which was the Spanish Civil War, beginning in 1936.
After the crushing defeat of the Nazis, world nations placed their hopes in the United Nations, which strives to generate cooperation in order to put an end to aggressions and wars, such that countries can preserve the peace, development and peaceful cooperation of the big and small, rich or poor States of the world. Millions of scientists could, among other tasks, increase the chances of the survival of the human species, with billions of people already threatened by food and water shortages within a short period of time. We are already 7.3 billion people on the planet. In 1800 there were only 978 million; this figure rose to 6.07 billion in 2000; and according to conservative estimates by the year 2050 there will be 10 billion.
Of course, scarcely is the arrival to Western Europe of boats full of migrants mentioned, traveling in any object that floats; a river of African migrants, from the continent colonized by the Europeans over hundreds of years. 23 years ago, in a United Nations Conference on the Environment and Development I stated: “An important biological species is in danger of disappearing given the rapid and progressive destruction of its natural life-sustaining conditions¬: man.” I did not know at that time, how close we were to this.
In commemoration of the 70th anniversary of the Great Patriotic War, I wish to put on record our profound admiration for the heroic Soviet people, who provided humankind an enormous service. Today we are seeing the solid alliance between the people of the Russian Federation and the State with the fastest growing economy in the world: The People’s Republic of China; both countries, with their close cooperation, modern science and powerful armies and brave soldiers constitute a powerful shield of world peace and security, so that the life of our species may be preserved.
Physical and mental health, and the spirit of solidarity are norms which must prevail, or the future of humankind, as we know it, will be lost forever. The 27 million Soviets who died in the Great Patriotic War, also did so for humanity and the right to think and be socialists, to be Marxist-Leninists, communists, and leave the dark ages behind.
bron: Granma
1.27.2015
70 jaar eind van de holocaust
vandaag is het exact 70 jaar dat het Sovjet leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijdde. Een uiterst belangrijke dag in de geschiedenis van de twintigste eeuw die we niet onopgemerkt mogen laten voorbijgaan.
een van de helden die er bij was beschrijft de onvoorstelbare hel die ze daar aantroffen:
Het nazisme en de gruwel behoren tot het verleden, niet in het minst, door de impressionante inspanningen van de Sovjet-Unie.
Laat ons vooral, op zo'n dag, niet vergeten en niet uit het oog verliezen dat demonisering en haatzaaierij een constante bedreiging blijven voor onze samenleving. Laat ons nooit toelaten dat xenofobie, hetze tegen asielzoekers, stijgende islamofobie en aanhoudend anti-roma-racisme onze samenleving zodanig vergiftigen dat mensenlevens bedreigt worden. En vooral dat gewone mensen zo in de ban geraken van haatzaaierij dat ze geen halt durven zeggen aan onmenselijke gruwel.
5.08.2014
8 mei
Dus, kameraden, vergeet de lessen van 1945 niet:
2.02.2013
70 jaar Slag om Stalingrad
Voor de liefhebbers, een lezenswaardige tekst van prof. Annie Lacroix-Riz
La capitulation de l’armée de von Paulus à Stalingrad, le 2 février 1943, marqua, pour l’opinion publique mondiale, un tournant militaire décisif, mais qui ne fut pas le premier. Cette victoire trouve son origine dans les préparatifs de l’URSS à la guerre allemande jugée inévitable : le dernier attaché militaire français en URSS, Palasse les estima à leur juste valeur. Contre son ministère (de la Guerre), acharné à faire barrage aux alliances franco-soviétique et tripartite (Moscou, Paris, Londres) qui eussent contraint le Reich à une guerre sur deux fronts, cet observateur de l’économie de guerre soviétique, de l’armée rouge et de l’état d’esprit de la population affirma dès 1938 que l’URSS, dotée d’« une confiance inébranlable dans sa force défensive », infligerait une sévère défaite à tout agresseur. Les revers japonais dans les affrontements à la frontière URSS-Chine-Corée en 1938-1939 (où Joukov se fit déjà remarquer) confirmèrent Palasse dans son avis : ils expliquent que Tokyo ait prudemment signé à Moscou le 13 avril 1941 le « pacte de neutralité » qui épargna à l’URSS la guerre sur deux fronts.Après l’attaque allemande du 22 juin 1941, le premier tournant militaire de la guerre fut la mort immédiate du Blitzkrieg. Le général Paul Doyen, délégué de Vichy à la commission d’armistice, l’annonça ainsi à Pétain le 16 juillet 1941 : « Si le IIIème Reich remporte en Russie des succès stratégiques certains, le tour pris par les opérations ne répond pas néanmoins à l’idée que s’étaient faite ses dirigeants. Ceux-ci n’avaient pas prévu une résistance aussi farouche du soldat russe, un fanatisme aussi passionné de la population, une guérilla aussi épuisante sur les arrières, des pertes aussi sérieuses, un vide aussi complet devant l’envahisseur, des difficultés aussi considérables de ravitaillement et de communications. Sans souci de sa nourriture de demain, le Russe incendie au lance-flamme ses récoltes, fait sauter ses villages, détruit son matériel roulant, sabote ses exploitations ». Ce général vichyste jugea la guerre allemande si gravement compromise qu’il prôna ce jour-là transition de la France du tuteur allemand (jugé encore nécessaire) au tuteur américain, puisque, écrivit-il, « quoi qu’il arrive, le monde devra, dans les prochaines décades, se soumettre à la volonté des États-Unis. » Le Vatican, meilleure agence de renseignement du monde, s’alarma début septembre 1941 des difficultés « des Allemands » et d’une issue « telle que Staline serait appelé à organiser la paix de concert avec Churchill et Roosevelt ».Le second tournant militaire de la guerre fut l’arrêt de la Wehrmacht devant Moscou, en novembre-décembre 1941, qui consacra la capacité politique et militaire de l’URSS, symbolisée par Staline et Joukov. Les États-Unis n’étaient pas encore officiellement entrés en guerre. Le Reich mena contre l’URSS une guerre d’extermination, inexpiable jusqu’à sa retraite générale à l’Est, mais l’armée rouge se montra capable de faire échouer les offensives de la Wehrmacht, en particulier celle de l’été 1942 qui prétendait gagner le pétrole (caucasien). Les historiens militaires sérieux, anglo-américains notamment, jamais traduits et donc ignorés en France, travaillent plus que jamais aujourd’hui sur ce qui a conduit à la victoire soviétique, au terme de l’affrontement commencé en juillet 1942, entre « deux armées de plus d’un million d’hommes ». Contre la Wehrmacht, l’Armée rouge gagna cette « bataille acharnée », suivie au jour le jour par les peuples de l’Europe occupée et du monde, qui « dépassa en violence toutes celles de la Première Guerre mondiale, pour chaque maison, chaque château d’eau, chaque cave, chaque morceau de ruine ». Cette victoire qui, a écrit l’historien britannique John Erickson, « mit l’URSS sur la voie de la puissance mondiale », comme celle « de Poltava en 1709 [contre la Suède] avait transformé la Russie en puissance européenne ».La victoire soviétique de Stalingrad, troisième tournant militaire soviétique, fut comprise par les populations comme le tournant de la guerre, si flagrant que la propagande nazie ne parvint plus à le dissimuler. L’événement posa surtout directement la question de l’après-guerre, préparé par les États-Unis enrichis par le conflit, contre l’URSS dont les pertes furent considérables jusqu’au 8 mai 1945. La statistique générale des morts de la Deuxième Guerre mondiale témoigne de sa contribution à l’effort militaire général et de la part qu’elle représenta dans les souffrances de cette guerre d’attrition : de 26 à 28 millions de morts soviétiques (les chiffres ne cessent d’être réévalués) sur environ 50, dont plus de la moitié de civils. Il y eut moins de 300 000 morts américains, tous militaires, sur les fronts japonais et européen. Ce n’est pas faire injure à l’histoire que de noter que les États-Unis, riches et puissants, maîtres des lendemains de guerre, ne purent vaincre l’Allemagne et gagner la paix que parce que l’URSS avait infligé une défaite écrasante à la Wehrmacht. Ce n’est pas « le général Hiver » qui l’avait vaincue, lui qui n’avait pas empêché la Reichswehr de rester en 1917-1918 victorieuse à l’Est.La France a confirmé la russophobie, obsessionnelle depuis 1917, qui lui a valu, entre autres, la Débâcle de mai-juin 1940, en omettant d’honorer la Russie lors du 60e anniversaire du débarquement en Normandie du 6 juin 1944. Le thème du sauvetage américain de « l’Europe » s’est imposé au fil des années de célébration dudit débarquement. Les plus vieux d’entre nous savent, même quand ils ne sont pas historiens, que Stalingrad a donné aux peuples l’espoir de sortir de la barbarie hitlérienne. À compter de cette victoire, « l’espoir changea de camp, le combat changea d’âme. » Ce n’est qu’en raison d’un matraquage idéologique obsédant que les jeunes générations l’ignorent.
7.24.2012
een beetje geschiedenis van Litouwen
Tijd voor een beetje achtergrond bij mijn vakantieland, Litouwen.

De Litouwers maken deel uit van de zogenaamde Baltische tak van de Indo-Europese familie, samen met de inmiddels verdwenen Pruisen en de Letten.

De eerste vermelding van een Litouwse staat, Litu stamt uit 1009.
In de dertiende eeuw wordt de eerste echte staat gevormd als gevolg van de oprukkende Teutoonse ridders. In 1219 wordt een verbond gesloten tussen de lokale machthebbers en krijgsheren. Ze sluiten zich aaneen in het Groot-Hertogdom Litouwen, onder Groot-Hertog Mindaugas.
In 1250 sluiten de Teutonen en de Litouwers een vredesakkoord, waarbij Mindaugas zich bekeerd tot het katholicisme en erkend wordt als vorst van Litouwen.
In 1253 werd het Koninkrijk Litouwen opgericht.
Kort daarop wordt de koning vermoord en breekt het geweld terug los. Ook de invallende Mongolen zorgen voor heel wat onrust.
In 1316 begint Groot-Hertog Gediminas aan zijn opmars. Met de hulp van Duitse kolonisten weet hij de Mongolen te verslaan en wordt een rijk uitgebouwd van de Baltische tot de Zwarte Zee.
Door deze beweging naar het oosten komt Litouwen in Orthodox vaarwater en de meerderheid van de aristocratie 'bekeerd' zich tot de Orthodoxe Kerk.
In 1377 krijgt Groot-Hertog Jogaila de kroon van Polen aangeboden en bekeerd zich prompt tot de Katholieke Kerk.
De gezamenlijke Litouws-Poolse legers weten de Teutoonse ridders definitief te verslaan in 1410. De personele unie met Polen zal aanhouden tot het midden van de zestiende eeuw.
In 1569 sluiten Polen en Litouwen de Unie van Lublin. Van dan af vormen het Koninkrijk Polen, het Hertogdom Pruisen, het Hertogdom Courland, Livonië en het Groot-Hertogdom Litouwen het Pools-Litouwse Gemenebest. Dit gemenebest wordt bestuurd door de hoge adel, die telkens een primus inter pares als koning verkiezen.
Er was tevens een vrij hoge mate aan religieuze tolerantie waarbij katholicisme, orthodoxie en calvinisme naast elkaar bestonden.
De tweede helft van de 17de eeuw bracht naast hongersnood en epidemien ook een reeks oorlogen: de kozakken-opstand van 1648 en de Noordelijke Oorlogen van 1655 – 1661.
In de jaren 1790 werd het Gemenebest ontbonden, Litouwen werd een onderdeel van het Russische Rijk. Het was trouwens Tsaar Alexander I die in 1803 de Universiteit van Vilnius oprichte, als grootste universiteit van het Rijk.
Na de Napoleontische Oorlogen werd Litouwen verdeeld over Polen, Pruisen en Rusland.
Allerlei nationale en democratische opstanden ten spijt bleef het land stevig deel uitmaken van Rusland tot aan de Eerste Wereldoorlog.
De Duitsers stimuleerden het 'onafhankelijkheidsstreven' en lieten op 16 februari 1918 het Koninkrijk Litouwen oprichten. Na de Duitse overgave werd Litouwen een onafhankelijke republiek.
In mei 1926 werd de linkse regering omvergeworpen door het leger, die samen met fascistische knokploegen de Litouwse Nationale Unie aan de macht bracht, onder president Smetona en premier Voldemaras. Al vlug werd de fascist Voldemaras aan de kant geschoven en Smetona regeerde als extreem-rechts dictator.
In 1939 vielen de Duitse nazi's Polen binnen, omdat het Rode Leger daarop Polen eveneens binnenviel mobiliseerde Smetona het Litouwse leger. Daarop werd Smetona afgezet en kwam een democratische regering aan de macht, die prompt een niet-aanvalspact sloot met de Sovjet-Unie. Het voorheen door Polen bezette Vilnius werd teruggegeven aan Litouwen. De linkse regering vroeg om de toetreding van Litouwen tot de Sovjet-Unie.
Maar de Duitse dreiging kon niet worden afgeweerd en in juli 1941 vielen de nazi's de Sovjet-Unie binnen. Terwijl de nazi's stevig huis hielden, en onder andere 190.000 Litouwse joden uitmoordden was er enthousiaste collaboratie van Litouws extreem-rechts.
Het ging zelf zo ver dat na de bevrijding Litouws extreem-rechts ondergronds ging en doorheen de jaren '40 en '50 een 'partizanen-oorlog' voerde. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden deze fascisten uitgeroepen tot nationale helden.
12.13.2011
december 1941 - keerpunt in de oorlog
Prof. Jacques Pauwels argumenteert dat toen het keerpunt van de oorlog plaats vond, niet omwille van Pearl Harbour, maar omwille van de Soviet tegenaanval.

The Soviet counter-offensive destroyed the reputation of invincibility in which the Wehrmacht had basked ever since its success against Poland in 1939, thus boosting the morale of Germany’s enemies everywhere. The Battle of Moscow also ensured that the bulk of Germany’s armed forces would be tied to an eastern front of approximately 4,000 km for an indefinite period of time, which all but eliminated the possibility of German operations against Gibraltar, for example, and thus provided tremendous relief to the British. Conversely, the failure of the Blitzkrieg demoralized the Fins and other German allies. And so forth…
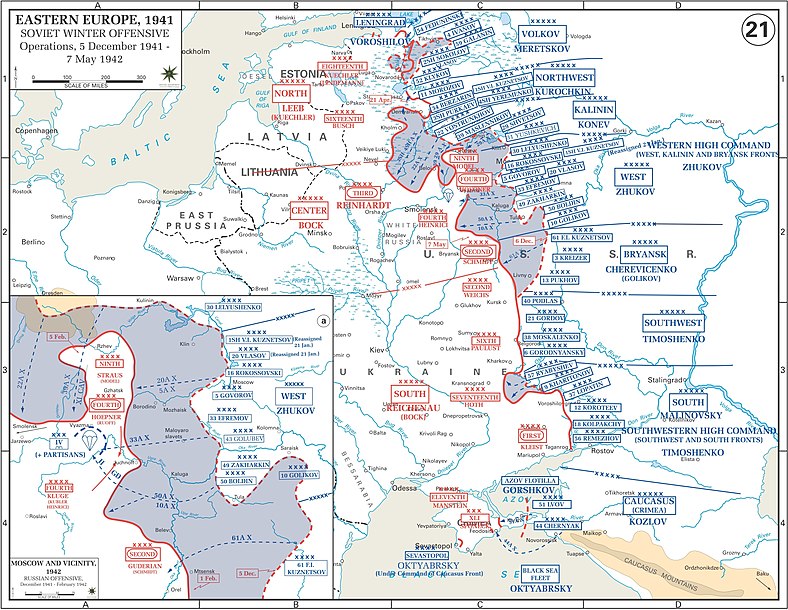
It was in front of Moscow, in December 1941, that the tide turned, because it was there that the Blitzkrieg failed and that Nazi Germany was consequently forced to fight, without sufficient resources, the kind of long, drawn-out war that Hitler and his generals knew they could not possibly win.
Lees het volledige artikel.














